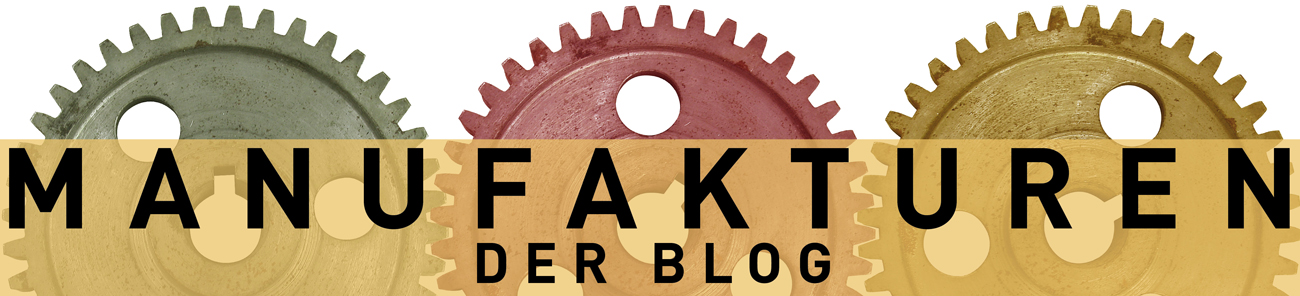Dornburger Schlösser – dort begann die moderne Manufaktur-Keramik
Dornburg. Vor drei Jahren hörte ich in der ‚Klappholttal – Akademie am Meer‘ auf Sylt während eines Urlaubsaufenthalts den Vortrag des bedeutenden deutschen Architekturkritikers Dankwart Guratzsch (‚Die Welt‘) zu ‚100 Jahre Bauhaus‘. Guratzsch verblüffte die Gäste mit einem Eröffnungsbild: Dies zeigte keineswegs die berühmten Schuhkartons aus Dessau in Glas und Weiß – sondern ein den Meisten unbekanntes Gebäude; natürlich das des ersten ‚Bauhauses‘ aus Weimar, des von Henry van de Velde entworfenen und errichteten Ateliergebäudes (1904 – 1911) der ‚Großherzoglich-Sächsischen Kunstgewerbeschule Weimar‘, die durch ihre Fusion im Jahr 1919 mit Walter Gropius‘ ‚Großherzoglich-Sächsischen Kunstschule Weimar‘ sich zum ‚Bauhaus‘ wandelte: Kunstgewerbe und Kunst vereint. Eine Idee, die dreizehn Jahre hielt – dann wurde das Bauhaus – über Dessau nach Berlin immer weiterverzogen – von den Nationalsozialisten verboten.
Noch weniger ‚form follows function‘ (ein berühmter Spruch des 3. Bauhaus-Direktors Ludwig Mies van der Rohe im US-amerikanischen Exil), als die Gebäude in Weimar, bietet das liebliche Gebäude der ersten Keramikwerkstatt (1920 – 1925) des Bauhauses: der Marstall der Schlösser in Dornburg. In dieser Orgie aus Rosa und Cremegelb, durch Gärten mit den drei Schlössern verbunden – darunter genau gegenüber dem Eingang das Jagd- und Lustschloss – steckten die Wurzeln der späteren ‚Neuen Sachlichkeit‘ und die Basis unserer heutigen Keramik von KPM-Porzellan bis Hedwig Bollhagen, teilweise auch Meissen und Schwarzburger Werkstätten. Der erste Leiter der Keramikwerkstatt wurde der Berliner Gerhard Marcks (1889 – 1981); dieser ist heute vor 41 Jahren gestorben.