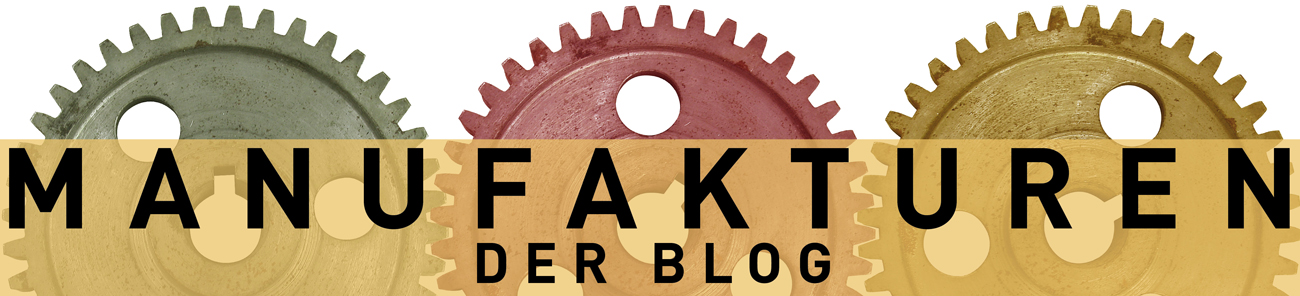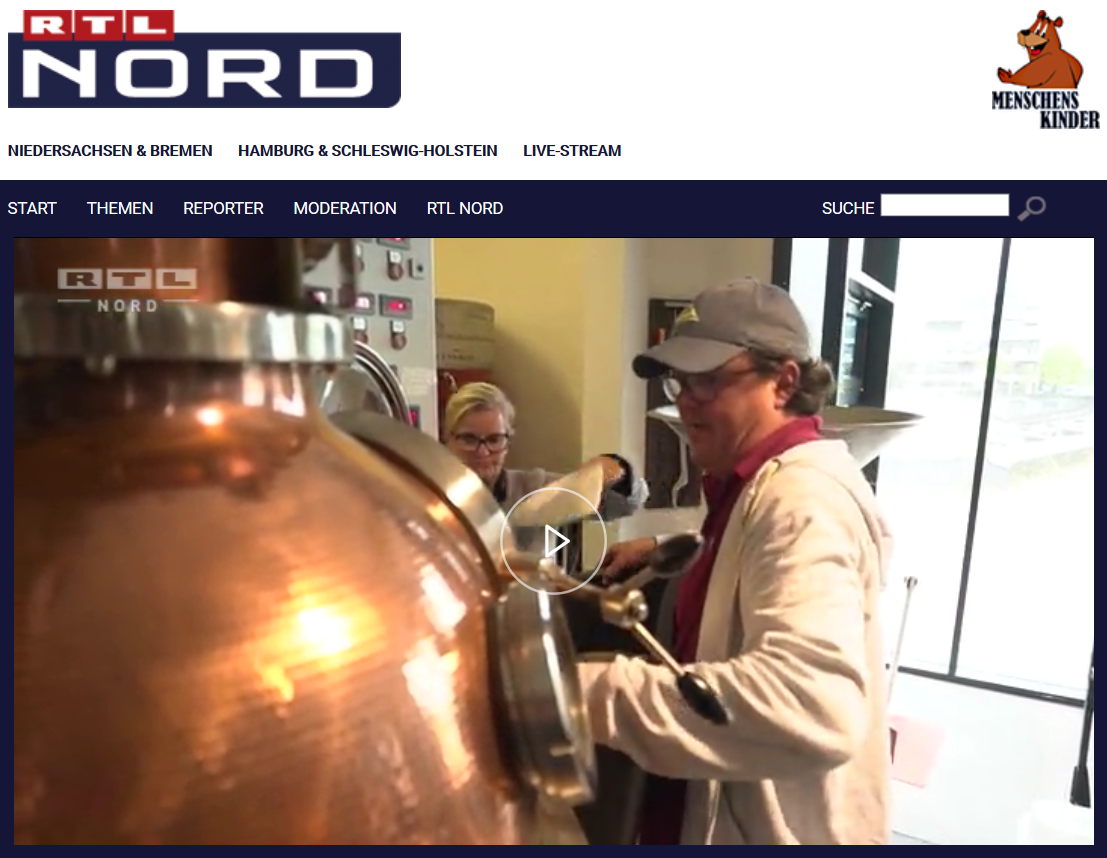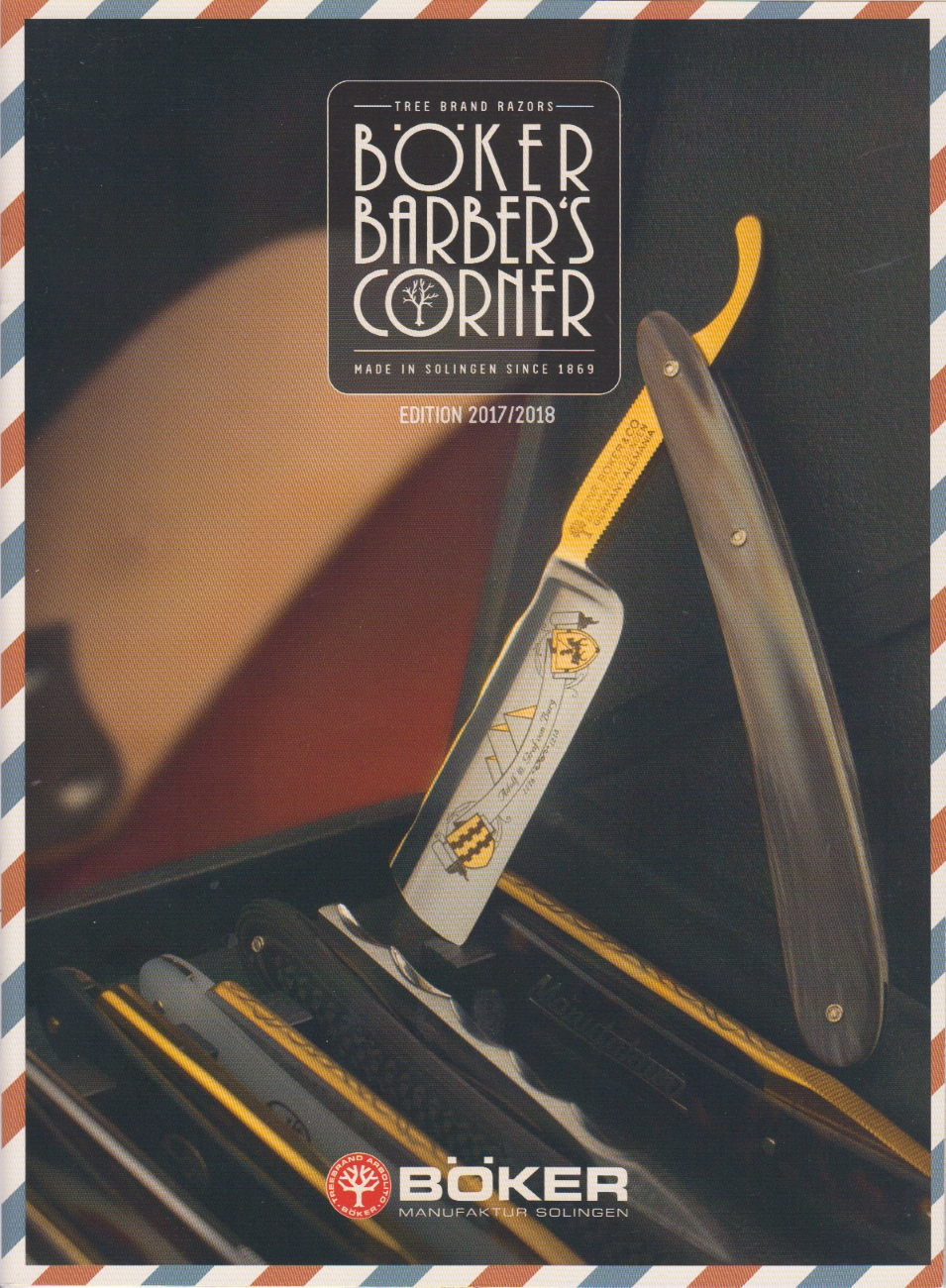Vom inneren Wert der Keramik
2. Juni 2022, Leipzig. Wer Porzellan sagt – muss eigentlich auch Keramik sagen. Denn viel früher als die Porzellan-Bewegung in Europa mit der Erfindung des ‚Weißen Goldes‘ durch Johann Friedrich Böttger im 18. Jahrhundert, schon Jahrtausende vor der Gründung der berühmten europäischen Porzellanmanufakturen, hatten Menschen mit dem Brennen von Ton begonnen: Mit der Sesshaftwerdung des Menschen weitete sich der Bedarf an Aufbewahrung aus – und so gelten Tonscherben als das Zeugnis für menschliche Siedlung schlechthin. Und wie steht es heute um die Keramik? Ein Blick auf Instagram zeigt: So manche Keramikerin und so mancher Keramiker hat viel mehr Follower, als die berühmten Porzellanmanufakturen. Aber bildet das auch die Wirklichkeit ab? Verdient man mit Keramik Geld? Geht handwerkliche Keramik – in Deutschland? Ich treffe mich mit der bekannten Keramikmeisterin Franziska M. Köllner in Leipzig.
„Porzellan ist überhaupt nicht mein Material – das ist mir zu hart und zu kalt“, sagt Köllner. Und wenn man ihr so zuhört, dann versteht man sehr gut, was sie meint. Vielleicht ist Keramik in unserer Vorstellung femininer, als Porzellan. Die Techniken der Verarbeitung sind in etwa gleich – jedoch haben beide Materialien ihre eigene Favorisierung: Während die konfigurierte Porzellanmasse (Porzellan ist kein Naturprodukt) meistens in Formen gegossen wird, wird Keramik aus dem in Tongruben abgebauten Naturprodukt entweder in Ringen ‚aufgebaut‘ oder mit der berühmten Drehscheibe gedreht und geformt. Techniken, die sich einfach anhören und beim Zuschauen auch tatsächlich so einfach erscheinen – aber im Detail liegt, wie bei Allem, die Kunst; und so unterscheidet sich die Enthusiastin im Volkshochschul-Kurs doch sehr von der Berufskeramikerin. Und die herrliche Albernheit von Leslie Nielsen und Priscilla Presley an der Töpferscheibe im Filmklamauk ‚Nackte Kanone‘ bringt unter den Fingern der Fachleute filigranes und hauchdünnes Geschirr hervor, das sich in Ausführung und Form kaum von Porzellan unterscheidet – und vom Laien auch nicht unterschieden werden können.
Franziska M. Köllner hat ihre Ausbildung in der Endzeit der DDR gemacht. Im Jahr 1968 geboren, verweigerte sie den Gang auf die Russisch-Oberschule, absolvierte, wie die meisten Schüler in der DDR, die 10. Klasse an der POS („Polytechnische Oberschule“) – und wollte – inspiriert durch ihre vielen Ferienaufenthalte im Künstlerkollektiv Schaddelmühle im Muldental bei Grimma – Keramikerin werden. Das gelang ihr sehr prominent: Sie wurde nach Kontaktanbahnung durch einen befreundeten Leipziger Galeristen im Jahr 1984 von Ulli Wittich-Großkurth in Jena aufgenommen; eine Frau, die man als eine der Ikonen der DDR-Keramik beschreiben könnte. Und so waren die Auftraggeber der Werkstatt und Meisterausbildung auch oft der Staatsrat und der FDGB, dessen Boss Harry Tisch (1927 – 1995) ein besonderer Fan der Keramik aus Jena war. Besondere Aufträge und große Vorbilder machen junge Auszubildende groß.
Trotz Wendewirren fand die Meisterausbildung in Jena statt und endet im Jahr 1992 glücklich mit dem Abschluss – jedoch mitten im Desinteresse der Bewohner der Post-DDR: „Es gab damals vor allen Dingen Begeisterung für neue Fernseher und alles Technische – aber nicht für einheimische Keramik.“ Und auf einmal fehlte die Hochschul-Reife doch und der Keramikmeisterin der Zugang zu einem universitären zweiten Anlauf.
Also der mühsame Weg über die Töpfer- und Keramikmärkte, über Praktika und freie Aufenthalte an Kunsthochschulen, die Besuche von Workshops im In- und Ausland auf der ganzen Welt.
Das elterliche Wohnhaus im Leipziger Westen bot Platz für die Werkstatt, die Garage wurde zur Galerie.

Lehrling Franziska Ende der 1980er Jahre in Jena – ein Foto neben einer Tasse aus ihrer heutigen Produktion.

Der Küchenfußboden aus Schaddelmühlener Keramik im Elternhaus verstärkte die Begeisterung für Keramik.

Blick in den bis oben gefüllten zehneckigen Brennofen

Mate-Kalebassen beim Trocknen

Im Atelier-Verkauf mit Geschirr im typischen Köllner-Grün – im Hintergrund ein Foto, das ihre Tochter Nina Emilia von ihr gemacht hat.
Wie es bisweilen so ist mit Garagen – es kamen immer neue Ideen: Eine Galerie für Keramik und anderes Kunsthandwerk musste her – also wurde die ‚Schwarz Weiß Werkstatt Galerie‘ in der ehemaligen Baumwollspinnerei mitbegründet. Noch besser wäre gleich ein Kunstverein: der ‚terra rossa e. V.‘ wurde ins Leben gerufen. Warum muss man für Keramikmärkte so weit reisen? Köllner entwickelte die Idee für den Keramikmarkt am Museumskomplex Grassi. Wie kommt man in den Handel? Na, noch direkter sind doch Pop-up-Stores, die sich nach der Phase des Experimentierens einfach dauerhaft etablieren, wie der in der berühmten Mädler-Passage.
Da kam vor einigen Jahren dieser Vietnamese in die Schwarz Weiß Werkstatt Galerie. Unentschlossen dreinschauend, offensichtlich kritisch, etwas suchend, die Tassen drehend und wendend. Auf die Frage, wie sie helfen könne, antwortete er: „Ich suche Teeschalen für mein Restaurant in einer ganz bestimmten Form. Wie ich sie von früher aus Vietnam kenne.“
In Leipzigs Westen wurde die Drehscheibe angeworfen, entworfen, gedreht, versucht, verworfen. „Mir fehlte noch das Bild, was er genau wollte“, räumt Franziska M. Köllner achselzuckend ein. Irgendwann war es so, wie es der Kunde sich vorstellte. Weitere asiatische Auftraggeber erschienen. Folgeaufträge schlossen sich an – Blumenvasen entstanden im Raku-Brand, Schalen für die Pho-Suppe entworfen, Stäbchen-Behälter kreiert. Asien ließ die Leipzigerin nicht mehr los. Sie bereiste Vietnam und Thailand – auf der Suche nach mehr Verständnis für die andere Keramik-Kultur.
In verschiedenen Werkstätten erbat sich Köllner einen Zugang zum Arbeitsplatz, begann sich vor Ort in das Teetrinken modellierend und formend hineinzuarbeiten, gewöhnte sich an die Drehscheiben, die andersherum, als die deutschen, drehen – irgendwann stand das Bild auch in ihrem Kopf, wie Tee „perfekt“ getrunken werden könnte.
Wer Tee sagt, sagt vielleicht auch Mate-Tee. Das Naturprodukt aus Südamerika nimmt seit Jahren auch in Europa einen Aufschwung. Glück für Köllner, dass das aufstrebende Unternehmen Caámate – Spezialist für Tee und Zubehör – in Laufentfernung zur Werkstatt seinen Sitz hat. Und dass Mate-Tee aus speziellen Keramikgefäßen – sogenannten ‚Kalebassen‘ – getrunken wird.
Seitdem sind viele Tausend Mate-Tee-Kalebassen, Kännchen und Schalen aus der Leipziger Werkstatt in den Tee-Accessoire-Handel gegangen. Losgrößen von zweihundert und fünfhundert sind an der Tagesordnung, es könnte von ihr noch viel mehr produziert werden, sagt sie – qualifizierte und engagierte Mitarbeiter wären gefragt, sind jedoch Mangelware, wie überall.
Nach meinem Besuch denke ich: Um das Interesse an Keramik steht es doch besser, als ich zuvor dachte – aber sie steht unter denselben Problemen, wie alle anderen Handwerksprofessionen auch; theoretisch „goldener Boden“ – praktisch sind zu wenige Menschen bereit, die sorgfältige Arbeit zu machen. Die sich in die alte Tradition der Bandkeramiker stellen wollen, die schon vor 9000 Jahren in unseren Breiten töpferten und ihre Waren verzierten – sprich: in den Dienst unserer Kultur. Die verstehen, wie man Design unter den Gegebenheiten des Materials umsetzen kann. Die bereit sind, zu erlernen, wie man Ton und Keramik zum Sprechen bringt – sie eine Geschichte erzählen lässt, sie als Produkt das unterstützen lässt, was auf und in ihnen präsentiert wird. Umso wichtiger ist für uns Kunden zu lernen, den inneren Wert und Anspruch der seltenen Schönheiten zu erkennen und zu verstehen – dort, wo wir ihnen begegnen.
Fotos: Wigmar Bressel