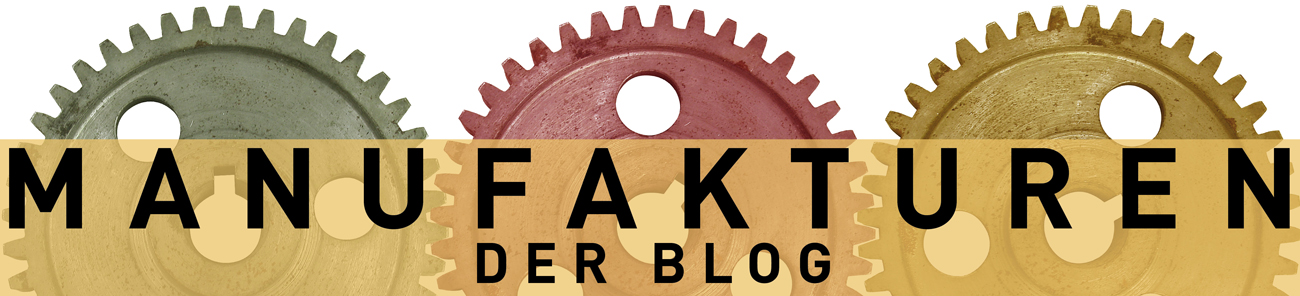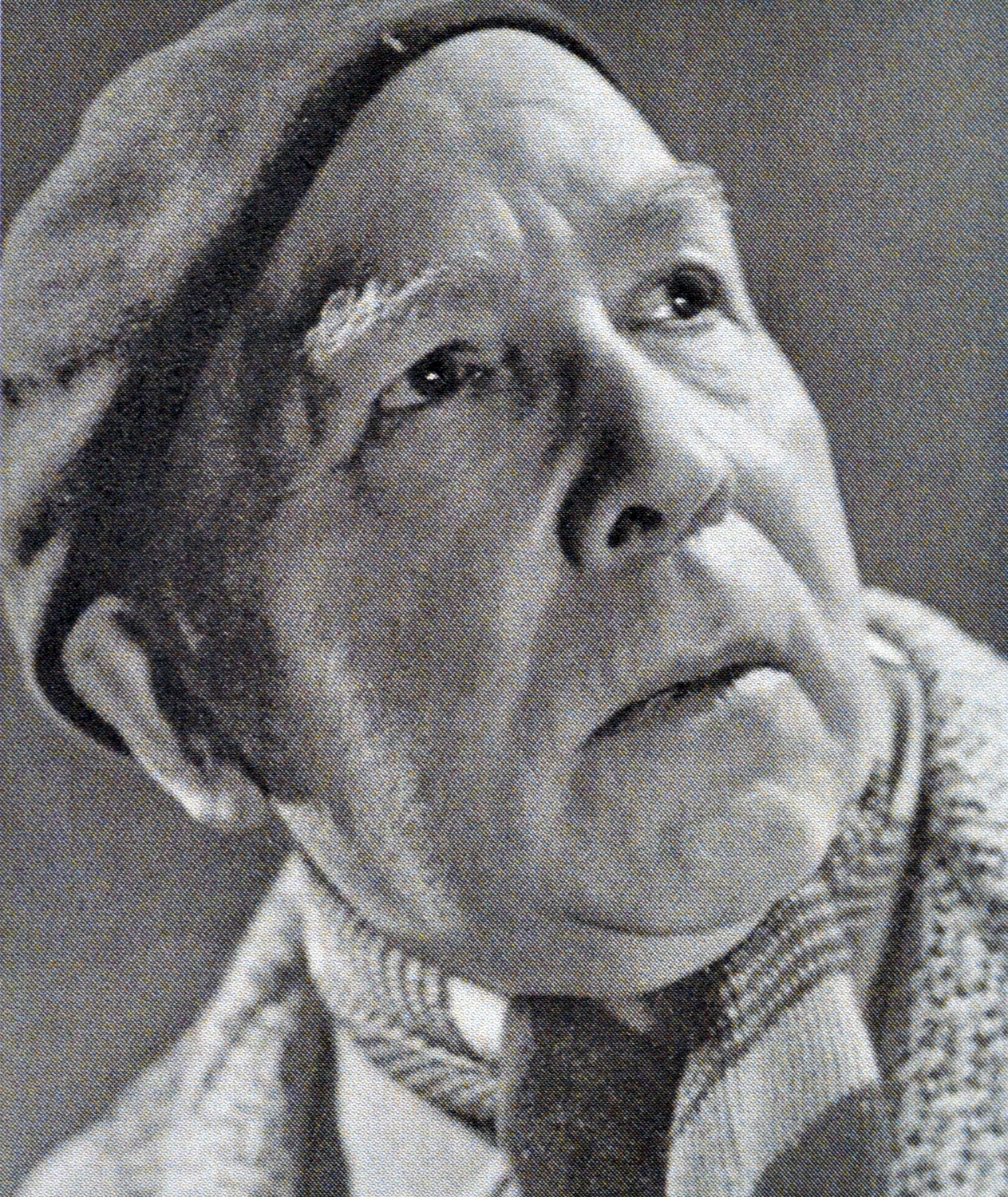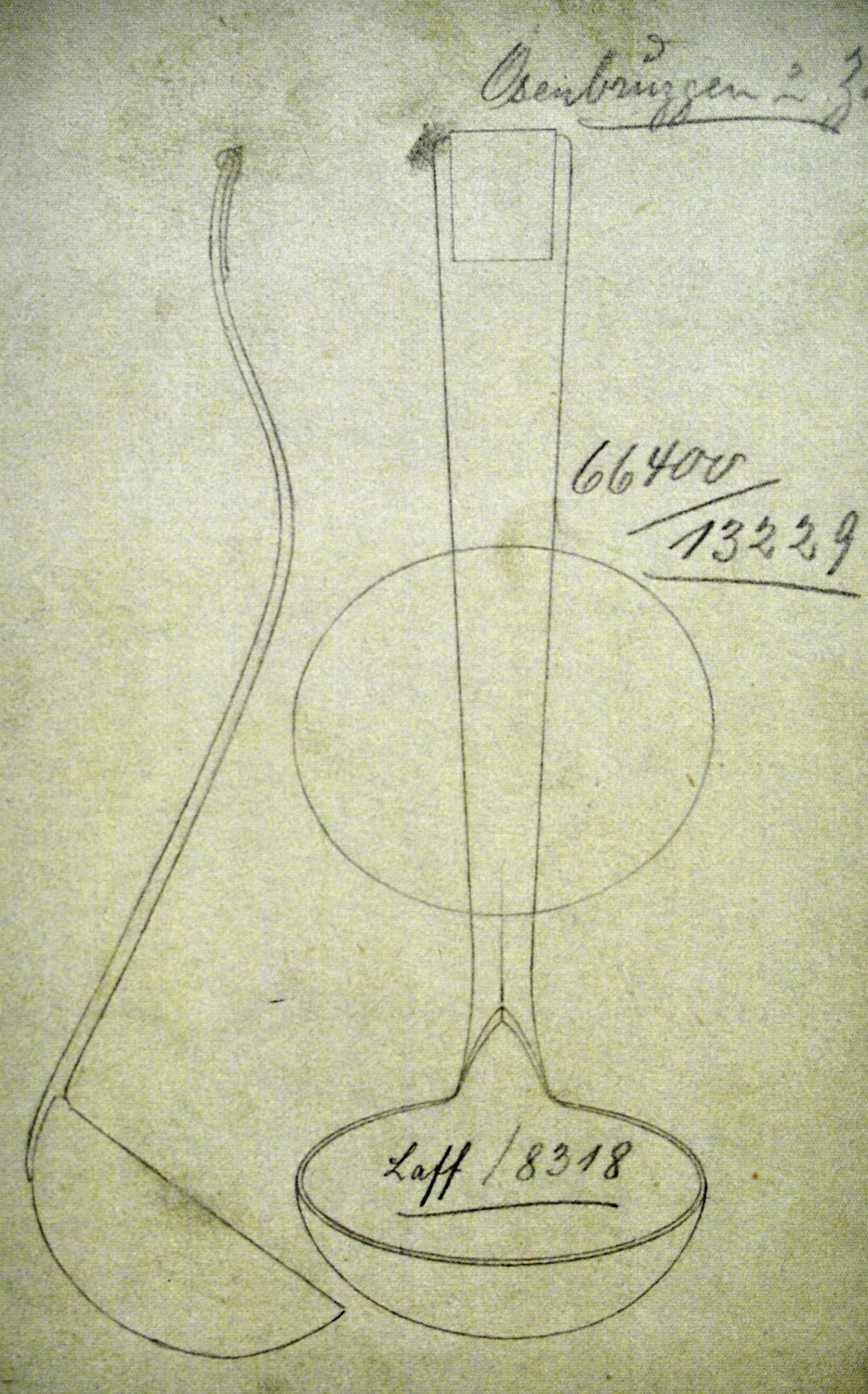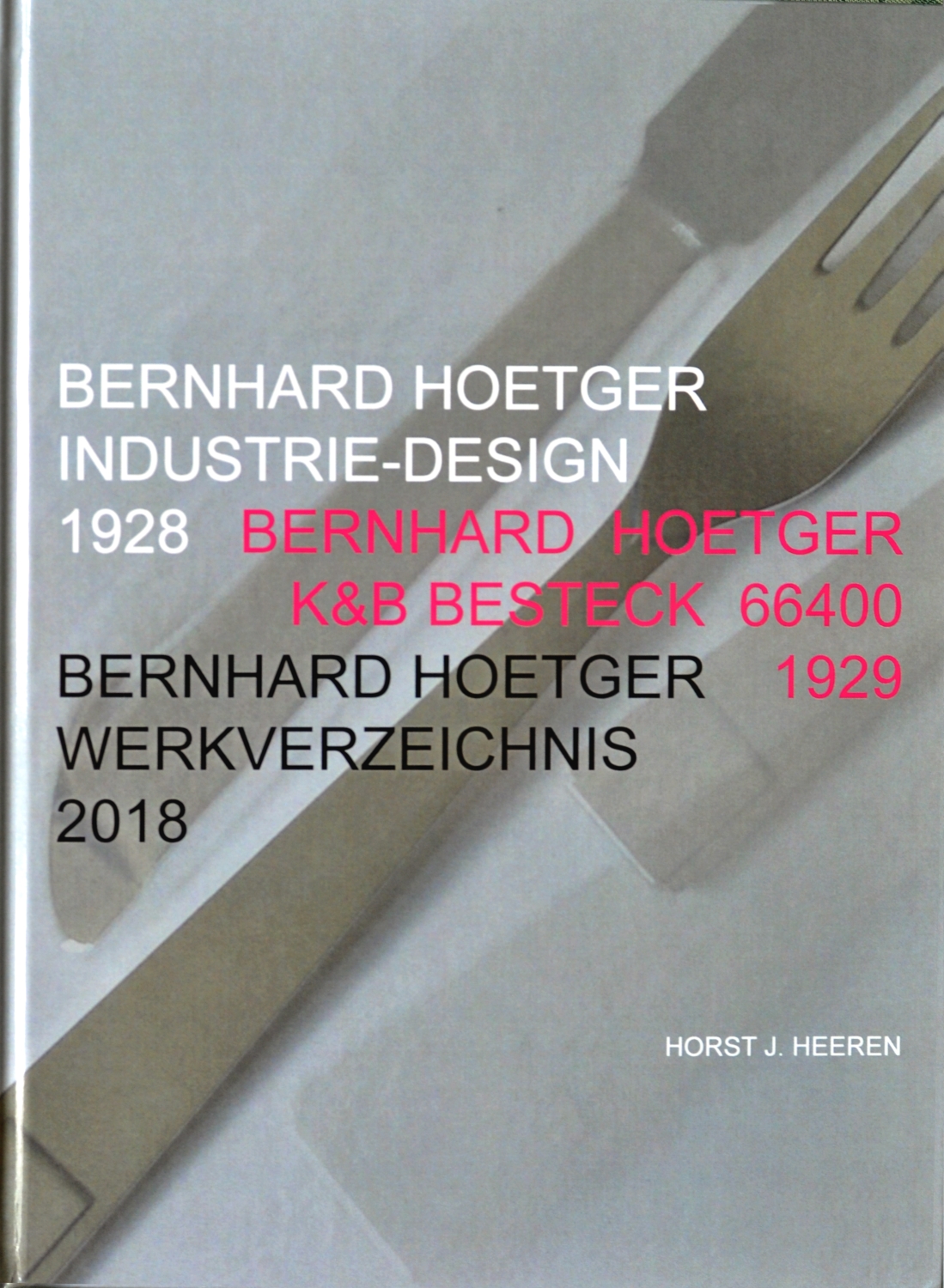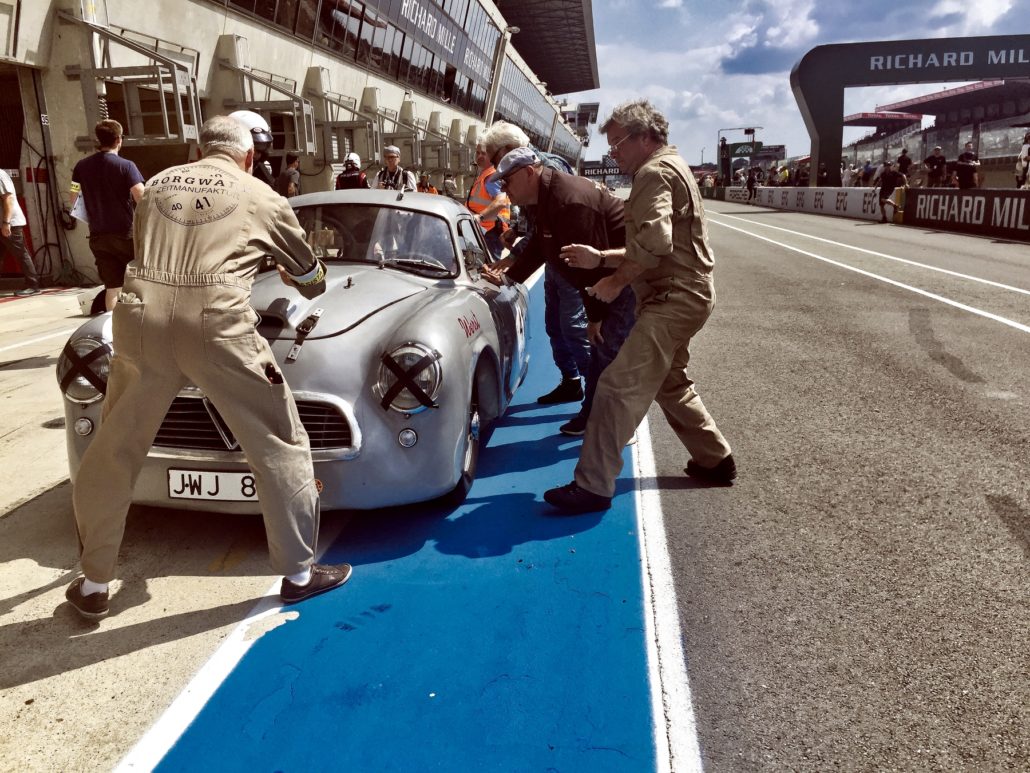Im Gespräch mit Martin Specht
„Zugang zu Menschen zu finden, ist das Aufwendigste, Wichtigste und Entscheidende“
Wigmar Bressel: Wie siehst du dich?
Martin Specht: Von heute aus betrachtet sehe ich mich vor allem als Autor der drei Bücher, die ich in den vergangenen drei Jahren veröffentlicht habe – zwei zur Fremdenlegion, eins zu den weltweiten Drogenkriegen. Bei mir geht es in meiner Karriere immer um Reportagen. Ich habe in den vergangenen 15 Jahre überwiegend beides gemacht – Texte und Fotos. Bei mir geht es immer um die Themen, unabhängig davon ob es in der Textsprache oder der Bildsprache stattfindet. Ich sehe mich schon als Journalist und Autor, der mit sehr verschiedenen Themen zu tun hat.
Aber du lässt dir die Themen doch durch die Auftraggeber vorgeben?
Beides. Ich entwickele selber Themen und schlage diese möglichen Auftraggebern vor – also Verlagen oder Redaktionen. Für mache Themen werde ich beauftragt – aber es ist eine Kombination aus beidem.
Gibt es Themen oder Geschichten, die du abgelehnt hast?
Nein, eigentlich nicht. Ich werde aber fast auch nur für die Themen beauftragt, bei denen man denkt, dass ich die Kompetenz dafür besitze. Manche Dinge sind trivialer als andere oder weniger komplex – aber im Grunde ist das Meiste schon interessant.
Warst Du schon überall auf der Welt? Warst Du auf allen Kontinenten?
Australien noch nicht. Viele Themen spielten in Afrika. Der Mittlere Osten natürlich, Lateinamerika, USA.
Europa sowieso.
Europa ist ja Lebensmittelpunkt.
Ist es für einen Journalisten heute egal, wo er lebt? Ist es egal, ob Wuppertal oder Berlin?
Ich denke, in einer globalisierten Welt und mit Zugang zu einem internationalen Flughafen, den es hier in der Nähe gibt, ist es ziemlich egal, wo man lebt. Ich muss nicht täglich irgendwelche Leute treffen, die ich nur an einem bestimmten Ort antreffe. Im Gegenteil – ich bin ja viel unterwegs…
Ist Wuppertal ein Rückzugsort, ein Refugium?
Für mich ist es Heimat. Ich habe hier meine Eltern, ich habe hier Freunde… Als Rückzugsort betrachte ich es nicht. Hier umgibt mich natürlich viel Vertrautes. Wenn ich über die Straße gehe, dann treffe ich Freunde, Bekannte. Ich lebe hier, ich arbeite hier, ich schreibe hier überwiegend an den Büchern…
Man könnte ja sagen, man wählt sich Wuppertal, um ein bisschen abgeschieden zu sein…
Ich sehe das nicht so. Ich lebe hier ganz komfortabel. Wenn ich arbeite, sitze ich vornehmlich in meinem Arbeitszimmer und würde dann auch nicht durch Berlin-Mitte schlendern. Also ich glaube es ist egal, in welcher Stadt ich in Mitteleuropa lebe.
Du bist ja dein ganzes Leben schon selbständig, warst auch noch nie angestellt – ist das wichtig für das Lebensgefühl des Journalisten Martin Specht?
Das hat sich einfach nur nie anders ergeben. Ich habe es mir nicht frei gewählt. Es ist so wie es ist – ich musste mich nie entscheiden.
Was ist das Spannendste, was du gemacht hast?
Immer das Nächste… Lateinamerika beschäftigt mich natürlich sehr. Das hängt sehr mit der Herausforderung zusammen. Das, was vor mir liegt, ist spannend, weil mich die Frage sehr beschäftigt, ob es mir gelingt, das neue Thema umzusetzen. Ich begegne Menschen, ich komme an fremde oder neue Orte – von daher ist das vor mir Liegende und Unbekannte immer das Spannendere.
Du hast viele Reportagen gemacht an aus der Sicht der Allgemeinheit sehr gefährlichen Orten. Und das ist ja eine Entscheidung zu sagen: Ich bin bereit, mitten in den Irak-Krieg zu gehen, ich bin bereit, in Afghanistan bei der Jagd auf Osama bin Laden mitzumarschieren, Motive zu suchen und zu finden, bei der man ja doch unter einer akuten Bedrohungslage ist. Da gibt es Schießereien und Querschläger – du hast mir mal geschildert, wie du mehrfach für mehrere Stunden unter Beschuss lagst. Man könnte sich ja auch sein Brot mit Reportagen verdienen, die eine viel höhere Wahrscheinlichkeit haben, dass einem nichts passieren kann…
Kann schon sein. Ich denk natürlich, dass man das macht, was man am besten kann und im Optimalfall, was einen interessiert. Diese Frage der Gefahr oder Nichtgefahr… Natürlich ist es gefährlich. Andererseits ist es dadurch natürlich auch interessant.
Dieses Interview in Deinem Buch ‚Narco Wars‘ mit dem Auftragskiller – wie geht man in solch ein Thema rein? War das Erfahrung? Hattest du ein ausreichend beruhigendes Bauchgefühl? Oder hattest du dabei Angst? Man will ja nicht vorgeführt bekommen, wie Menschen ermordet werden, möchte auch nicht selbst zum Abschluss ermordet werden…
Ach Angst eigentlich nicht. Das war spannend. Jedesmal ist es auch wieder neu. Dieser Begriff der ‚Erfahrung‘ ist nur relativ zu nutzen. Auch wenn ich mich seit Jahren in diesen Ländern bewege, ist der Unberechenbarkeitsfaktor doch hoch. Jedesmal ist wieder neu. Ich versuche mich nicht mit ‚Erfahrung‘ in falscher Sicherheit zu wiegen. Bei manchen Leuten habe ich ein gutes Gefühl – wie bei jeder zwischenmenschlichen Beziehung. Bei anderen Leuten denke ich: Okay, besser etwas vorsichtiger. Bei Kriminellen bin ich generell sehr vorsichtig – sie sind eben kriminell…
…du hast doch auch mal diese große Mara-Reportage gemacht…
…genau, diese Leute sind kriminell, sie sind zum Teil auch drogenabhängig und wissen auch nicht immer, was sie tun. Und mögen auch nicht immer Journalisten. Manchmal ja, manchmal nein. Das kann sich ändern und kippt dann auch schon mal während der Reportage, es kann sich im Zuge einer Begegnung schlagartig ändern. Ich bin grundsätzlich schon vorsichtig.
Aber man kann ja solch einer Situation dann oft nicht schnell entkommen.
Man muss den Leuten begegnen und sich anhören, was sie zu sagen haben.
75 tote Journalisten im Jahr 2016.
Ja, es werden jedoch überwiegend die Journalisten umgebracht, die permanent in diesen Ländern leben. In Mexiko zum Beispiel. Für mich, der ich mich dort maximal zwei-drei Monate aufhalte, sehe ich das nicht so als Problem. Aber für die, die da wirklich leben, mit ihren Familien, bekannt sind. Und die Drogenkartelle besitzen natürlich auch Radio- und Fernsehsender. Der von mir in ‚Narco Wars‘ beschriebene und sehr bekannte ‚Drogenbaron‘ Pablo Escobar war Herausgeber einer Zeitung, des Medellin Civico – von daher sind dann auch die Journalisten, die für diese Medien arbeiten, Teil des Geschehens.
Du beschreibst eine Szene in Mexiko, in der du mit einem Informanten unterwegs bist. Dann passiert etwas in einer Seitenstraße. Ihr haltet an, macht ein paar Fotos – dann entscheidet ihr, doch weiterzufahren, weil die Situation „aggressiv“ wurde. Lebt der Informant noch, hast du zu ihm noch Kontakt?
Ja, tut er. Ich versuche grundsätzlich, den Kontakt zu allen Informanten zu halten, so gut es geht. Vor allem natürlich zu den Informanten, die mir sehr geholfen haben. Das ist auch für mich wichtig. Für mich enden Geschichten ja nicht nach einer Veröffentlichung – ich komme da immer wieder drauf zurück, nutze Informanten wieder, wenn ich wieder in das Land komme.
Das Wichtigste sind für Dich und Deine Kontakte also funktionierende Kontakte.
Zugang zu Menschen zu finden, ist das Aufwendigste, Wichtigste und Entscheidende – und die halte ich dann natürlich auch.
Wird dir in diesen Ländern immer geglaubt, dass du Journalist bist? Oder wird manchmal auch vermutet, dass du doch für einen ausländischen Dienst arbeitest?
Wenn man es vermutet, vermutet man es – aber ich glaube eher nicht. Ich bin eher der nette deutsche Journalist.
Du machst gerade ein Buch für den Ch. Links Verlag über Kolumbien – das Land. Was gibt es zu entdecken?
Die Kultur, die Geschichte – es hängt natürlich auch wieder eng mit der Drogenproblematik zusammen. Es gibt da aber viele Gebiete, die angenehm und interessant sind und in denen man sich bewegen kann. Die Natur ist grandios. Das Problem ist allerdings, dass es schon schlagartig unangenehm werden kann, wenn man die touristischen Pfade verlässt. Sich in den großen Städten aufzuhalten, ist meiner Meinung nach kein Problem – oder an der Karibikküste. Da gibt es wirklich nette Orte, da kann man Urlaub machen.
Wenn du jetzt nach Medellin zurückkehrst, um an dem Kolumbien-Buch weiterzuarbeiten – hat das dann jemand mitbekommen, dass ‚Narco Wars‘ erschienen ist?
Ja, ich habe darüber sogar dort an der Universität von Antiochia mit Studenten diskutiert. Das wissen die Leute schon.
Und wie sehen die Studenten das so?
Für die heute Anfang bis Mitte Zwanzigjährigen sind Pablo Escobar und das Medellín-Kartell Geschichte. Sie wissen natürlich, dass es immer noch Drogenkriminalität in großem Stil gibt, aber die ist heute weniger auffällig, verborgener. Das spektakulärere Geschehen findet inzwischen in Mexiko statt. Natürlich hängt es zusammen. Für die Studenten ist der Friedensprozess mit der FARC und der ELN ein wichtiges und vieldiskutiertes Thema.
Du warst jetzt ja gerade wieder im Irak, warst beim sogenannten ‚Sturm auf Mossul‘ dabei, sagst: Es ist dort so kaputt, wie noch nie.
Es wird immer kaputter.
Du erzählst, dass es in der arabischen bzw. islamischen Welt eine große Unruhe gibt, die du mit einem dritten Weltkrieg vergleichst, da die schweren bewaffneten Auseinandersetzungen sich quer durch Afrika über den Golf bis nach Pakistan ziehen.
Also für die muslimische Welt ist es im Moment schon wie ein Weltkrieg. Die massiven Zerstörungen. Die ständige Angst, Bombardements und Beschuss ausgesetzt zu sein, der Willkür des Krieges, jedes Sicherheitsgefühl verloren zu haben. Das erzeugt die großen Flüchtlingsbewegungen: Syrien, Irak, Afghanistan, Jemen – selbst Pakistan. Einige dieser Staaten scheinen auch zu zerfallen. Kein Mensch weiß, wie lange es den Irak noch geben wird. Die Folgen sind schon gravierend.
Wie sehen denn deine Informanten und Kontaktpersonen die Situation? Sie erleben ja die Zerstörung ihrer uralten Kulturen und Landschaften. Fordern sie von uns mehr Engagement? Oder sollen wir uns raushalten?
Ich glaube, in Syrien und im Irak haben sich schon viele Menschen ein stärkeres Eingreifen und Engagement des Westens gewünscht.
Das sind ehemalige Kolonien – es gab ja früher kaum nicht-kolonialisierten Raum…
Man darf nicht vergessen, dass ein Teil dieser Länder zuvor Gebiete und Regionen des Osmanischen Reichs waren oder zu dessen Einflussbereich gehörten – denn die osmanischen Sultane waren ja auch kolonial; sogar imperial, wenn man will. Es war nicht nur Europa, das Kolonien unterhielt.
In Mali hat der überwiegende Teil der Bevölkerung das Eingreifen der früheren Kolonialmacht Frankreich begrüßt. Mali hatte keine richtige Armee. Es gab da trotzdem einen Militärputsch, der das Land aber so geschwächt hat, dass diese fundamentalistischen Milizen im Anschluss weite Teile erobern und sich dort halten konnten. Mali hatte dem nichts entgegenzusetzen, keine echte Armee, die denen hätte begegnen können. Das ging nur mit Hilfe von außen.
Ist die Idee vom Nationalstaat für diese Regionen noch zeitgemäß?
Die Kulturen sind alt, die Völker, die dort leben, sind da schon sehr lange und viel länger, als die in der jüngeren Vergangenheit willkürlich mit dem Lineal auf Karten gezogenen Grenzen. Der Staat wird überall dort Bestand haben, wo er von der Bevölkerung als positiv angesehen wird. Aber wenn der Staat nur so wahrgenommen wird, als wäre er mit Checkpoints überzogen, wo mir auch noch Geld abgenommen wird, wenn ich von einem Ort zum Nächsten fahren will. Der korrupt ist und dann noch dem erstbesten Feind, wie dem IS, ein Drittel des Landes kampflos überlässt – da stellen sich viele Menschen die Frage: Was bindet mich an diesen Staat?
Wo starke ethnische Konflikte vorhanden sind, wo Korruption herrscht oder der Staat schlicht unfähig ist – diese Staaten werden meiner Meinung nach wieder zerfallen.
Wie groß ist deiner Meinung nach das Kurden-Thema für die nördlichen Teile der damit konfrontierten Staaten – glaubst du, dass es einen Kurdenstaat geben wird?
Hängt davon ab, wer sich dafür interessiert und einsetzt. Die Kurden versuchen das seit vielen Jahren, haben jetzt eine Autonomie im Nord-Irak. Es ist meiner Meinung nach eher eine wirtschaftliche Frage. Und: Wer würde ihn anerkennen? Ohne das geht es ja auch nicht. Wenn die Kurden morgen einen Staat ausriefen und Krieg mit der Regierung in Bagdad – an der sie ja beteiligt sind – darüber führten, dann wäre es doch die Frage, wer diesen neuen Staat anerkennen würde.
Die Türken werden es nicht anerkennen.
Die Türken werden es nicht anerkennen.
Ich weiß es nicht. Es hängt auch davon ab, wie sich der Irak weiterentwickelt. Es gibt bestimmt Gruppen, die es wollen. Es gibt Andere, die es nicht wollen. Es reduziert sich auf die Frage: Wer erkennt ihn an und wer würde ihn schützen.
Also hängen die Kurden doch von unser aller Haltung ab – und weniger von sich selbst.
Ich würde es sagen, ja. Die kurdische Armee hat keine schweren Waffen…
…weil sie ihr auch keiner gibt.
Genau. Im Moment sind die Kurden wichtig als Verbündete im Kampf gegen den IS. Aber die Städte Erbil und Kirkuk sind auch Wirtschaftsstandorte und Machtzentren, Kirkuk hat Öl. Durch sie läuft der Handel mit der Türkei. Andererseits hat Kurdistan auch viele Parteien mit unterschiedlichen Interessen – das ist auch keine einfache Ausgangslage. Aber ich kann es echt nicht einschätzen, wie das ausgeht.
Nationalstaaten oder größere Staaten bieten ja auch Chancen. Im afrikanischen oder afghanischen Stammes-Flickenteppich – ohne Nationalstaat als Klammer – gäbe es dann für viele Volksgruppen eben keinen Zugang zu Universitäten, kein funktionierendes Versicherungssystem, vielleicht keine Krankenhäuser. Wenn die Masse des Steueraufkommens zu gering ist, funktionieren viele Sozial- und Infrastrukturleistungen nicht, sie können nicht stattfinden.
Ja, das ist so.
Was gibt es für eine Geschichte, die du noch unbedingt machen musst? Zur ISS hochfliegen?
Schön wär’s… Ich würde gerne. Bestimmt interessant. Der ferne Blick. Auf die Erde. Aufs Ganze.
Aufgezeichnet am 19. Dezember 2016 bei Martin Specht in Wuppertal in der Küche sitzend und Kaffee trinkend, nachdem wir auf meinen Wunsch die erste Fahrt meines Lebens mit dieser weltberühmten Schwebebahn gemacht haben – aber auch Martin Specht war von der Tour begeistert: „Hey, das sind ja die neuen Wagen. Die sind gestern erst indienstgestellt worden – mit denen bin ich auch noch nicht gefahren!“