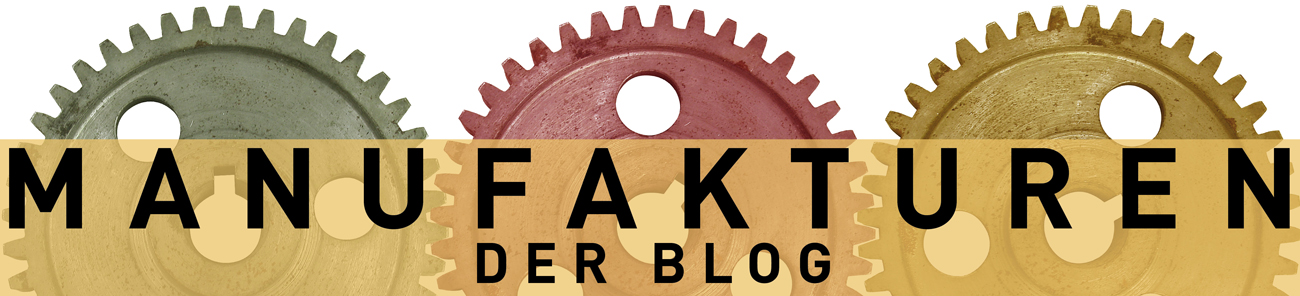Kein Bling Bling – von der Sehnsucht nach der deutschen Manufaktur
19. Januar 2025, Bremen. Letzten Endes ist der NSA-Abhör-Skandal doch zu etwas gut. Die Revolution blieb zwar aus – aber die Erschütterung über das Ausspähen der verbündeten deutschen Bundesregierung blieb. In jedem von uns ein bisschen. Der eine Großteil meiner Bekannten hat gesagt: Ich habe es schon immer gewusst. Der andere Großteil hat gesagt: Bei mir gibt es für die nichts zu holen. Getroffen hat es aber trotzdem jeden – ein Stück persönliche Sicherheit ist weg, wenn Sicherheitsprogramme uns weltweit heimlich hinterher spionieren. Man erinnert sich gerne und wehmütig an den angeblichen Trend „Cocooning“, das sich zu Hause Einspinnen, der vor zehn Jahren in Wohnwelten und Küchen eingetroffen war: Man lud wieder zu sich nach Hause ein, präsentierte sich ein Stück privater, als im Restaurant oder Club. Heute denken wir: Hätten wir das bloß noch ein bisschen öfter gemacht, statt uns so bei Facebook auszutoben. Und beim Blick auf das Smartphone wird uns klar, was dieses vom handgeschliffenen Kochmesser unterscheidet: Beide können etwas – das Smartphone super telefonieren und das Messer super schneiden; beide können auch etwas nicht – nämlich in den Geschirrspüler. Während das Smartphone nun aber heimlich weitermeldet, mit wem kommuniziert wurde, behält das Messer für sich, was es geschnitten hat.
Die Ausspäh-Affäre wird eine alte Sehnsucht der Menschen verstärken – die Sehnsucht nach Ehrlichkeit und Verlässlichkeit, auch der Dinge im persönlichen Umfeld. Das handgeschmiedete Messer und all die anderen wunderbaren Dinge aus den Manufakturen. Dinge, die nicht im Industrieland A teuer erdacht, im Schwellenland B günstig designt und dann im Schwellenland C unter menschenunwürdigen Verhältnissen billigst gefertigt wurden, und deren Dreck und Müll anschließend in den Entwicklungsländern D – Z nahezu umsonst verklappt wurden. Der Rasierpinsel aus dem Erzgebirge, der thüringische Osterhase aus der Marolin-Masse, das Porzellan aus Niedersachsen, die Rosshaar-Handtasche aus Obertshausen, unser Silber-Besteck aus Bremen – natürlich die Form „Spaten“, noch entworfen von unserem Firmengründer Gottfried Koch im Jahr 1829. Sehnsucht nach Versprechen, die gehalten werden. Nachhaltig. Nicht Luxus, nicht bling-bling. Denn es geht nicht um teuer, sondern es geht um gut. Teuer, Luxus – diese Worte umschleicht schon das Wort Verrat. Kein Mensch kann sagen, was an einem Stretch-T-Shirt mit einer großen Werbeaufschrift auf der Brust und gefertigt in Bangladesch teuer sein kann. Außer der Verkäufer, der aus 14 Euro Einkaufspreis im Mix mit einer hohen Ladenmiete in einer der weltweiten Metropolen, kombiniert mit dem virtuellen Attribut einer internationalen Marke 140 Euro aus dem Portmonee des Kunden hervorgezaubert bekommt. Dabei steht an der nächsten Ecke schon der bitterarme Wirtschaftsflüchtling, der das scheinbar gleiche Produkt zum Viertel des Preises anbietet und flüstert: „Das kommt aus derselben Fabrik, wie das Original…“
Aber neben ihm steht kein Kollege mit einer Kopie des Mühle-Rasierpinsels aus dem Erzgebirge, mit einem handgeschliffenen Messer aus Rosen-Damast wie aus der Manufaktur Gehring in Solingen oder von unserer Sterlingsilber-Gabel aus Bremen. Mag sein, dass er in der Lage wäre, in Indien einen Billig-Nachbau des echten Polos von Maximilian Frey aus Limbach-Oberfrohna in Sachsen zu beschaffen – doch der avisierte Kunde glaubt nicht an schadstoffreie Bio-Baumwolle für 15 Euro pro Shirt. Er will auch nicht, dass seine Freunde glauben, dass Polo-Shirt sei echt, sondern er will in jedem Fall den Haut-Juckreiz vermeiden. Wo es um Inhalt, Nachhaltigkeit und kleine Stückzahl aus der Manufaktur geht, tun sich Betrug und Verrat schwer. Wer billig kaufen muss, geht gleich zum Discounter – und hat auch kein Geld für das in Wirklichkeit doch recht teure Label-Fake. Insofern haben all die Hersteller, die ihre Produktion nach Asien „ausgelagert“ haben, um den Kunden auf dem Heimatmarkt einfach irgendetwas billiger zu liefern, selbst schuld daran, dass sie sich jetzt mit ihren Kopisten herumschlagen dürfen.
Ein gutes Beispiel dagegen ist Auerbach, die Berliner Krawatten-Manufaktur: Auch in den Kellern der Hackeschen Höfe werden keine Seidenraupen gehalten – aber die Krawatten entworfen und in Handarbeit zugeschnitten, gelegt, gefälzt und teilweise sogar noch Heimarbeit – eine Produktionsform aus den Wirtschaftswunderjahren des Arbeitskräftemangels – genäht. Und am Luxus-Point-of-Sale verkauft.
Die viel geringere Marge macht nicht immer Spaß, doch sie gibt vielerlei Arten von Bodenhaftung. Die große Mühe, die es macht, täglich wieder Hunderte von Kunden zu finden, sichert Arbeitsplätze – zum Beispiel eben in Berlin. Wer weiß, wie man in Deutschland produzieren und leben kann, der ist nicht so leicht ersetzbar, der ist nicht beliebig und überflüssig. Denn er kennt ja offensichtlich das Geheimnis, wie das geht, was wir alle wollen.
Als wir unseren Verband Deutsche Manufakturen e. V. im Sommer des Jahres 2010 gegründet haben, haben wir zuvor diskutiert, wie sehr der Begriff Luxus mit unserem Anliegen verknüpft ist. Luxus – ja was ist eigentlich Luxus? Umgangssprachlich ist es schon die eisgekühlte Dose Cola an einem heißen Sommertag. Vor dem inneren Auge ist es vielleicht der Diamant-Ring für 300 000 Euro des weltweit bekannten Marken-Juweliers. Vielleicht ist es auch die Entscheidung, wenn einem auf Ibiza langweilig ist, eben mal schnell die drei Stunden mit dem eigenen Privatjet nach Kairo zu fliegen, nur für das Abendessen. Na gut, das ist schon Dekadenz…
Uns wurde schnell klar, dass es nicht um die Frage ging, wie viel Luxus in einem Manufaktur-Produkt steckt. Für den einen ist es schon Luxus, wenn er ein 13-Euro-Gemüseputzmesser von Robert Herder aus Solingen benutzt, statt des asiatischen Ein-Euro-Messers von Tedi und Konsorten. Für den anderen beginnt Luxus erst bei maßgeschneiderten Hemden und Blusen von Campe & Ohff aus dem hessischen Lauterbach für 95 Euro oder für Maßanzüge von Puls aus Kirchgellersen ab 800 Euro, die sich auch unser damaliger Vize-Kanzler Philipp Rösler schon leistete.
Es war auch relativ klar, dass wir uns mit Mindestanforderungen bei den Mitarbeitern nach unten von fünf – in Abgrenzung zu den Kunsthandwerkern – und nach oben mit 200 statt 250 oder 300 willkürliche Grenzen auferlegten. Doch Grenzen sind auch hier nötig, denn wo es keine Mitarbeiter gibt und keine arbeitsteilige Produktion, da kann man nicht von Manufaktur sprechen.

Eröffnung des Flagship-Stores der Krawattenmanufaktur Edsor Kronen in den Hackeschen Höfen in Berlin im Jahr 2011 mit dem Dresscode ‚Black tie‘ – v. l. Hemdenmanufakteur Christian von Campe, Krawattenhersteller Jan-Hendrik Scheper-Stuke, Bundeswirtschaftsminister Philipp Rößler, Wigmar Bressel von Koch & Bergfeld

Bundeswirtschaftsminister Philipp Rößler als besonderer Gast bei Jan-Henrik Scheper-Stuke
Und wer so viele Mitarbeiter beschäftigt, dass es auf die Handwerkskunst der vielen Einzelnen überhaupt nicht mehr ankommt – auch da macht es keinen Sinn, den Begriff Manufaktur zu verwenden, denn dann wäre er ja nur ein Synonym für Mittelstand.
Gar keine Diskussion gab es beim Produktions-Standort Deutschland. Wer in einen Verband hinein möchte, der Deutsche Manufakturen heißt, muss seine Sachen in Deutschland selbst machen. Und damit war uns allen auch klar, was uns wirklich bewegt. Nicht die Marke, sondern die Fertigung von Produkten. In Deutschland. Das Einhalten von Spielregeln, die unsere Gesellschaft aufgestellt hat. Das Fertigen von Produkten für die Kunden aus unserer Gesellschaft. Und damit war auch klar, dass es nicht um Luxus und Marke gehen konnte, sondern um Nachhaltigkeit und Verantwortung innerhalb dieser Gesellschaft. Es geht um das Einhalten von deutschen und europäischen Normen: Energiesparen, Schadstoffausstoß, Inklusion – unser Unternehmen Koch & Bergfeld beschäftigt seit mehr als 100 Jahren gehörlose Mitarbeiter, zu den gleichen Konditionen wie nichtbehinderte Mitarbeiter. Damit will ich gar nicht sagen, dass wir ein besonders guter Arbeitgeber seien; andere mögen es viel besser machen als wir. Aber wir machen es wenigstens. Es stand für uns nie zur Debatte, Kinder in der nordkoreanischen Sonderwirtschaftszone auszubeuten. Denn unsere Meinung ist: Wenn unsere Kunden die notwendigen Preise nicht bezahlen wollen, können Sie halt nicht mit deutschem Silberbesteck essen. Geht es um Luxus? Nein. Geht es um Nachhaltigkeit? Ja. Natürlich, diese Haltung muss man sich aber auch erst einmal leisten können oder wollen, ist schon klar.
Wenn Sie an die beste Ledertasche denken, die Sie sich vorstellen können – fällt Ihnen dann ein Importprodukt ein? Vielleicht noch das von Hermès. Aber kaum eines aus Indien oder China. Dabei könnte diese Tasche vielleicht von Simone Tholl aus Halle an der Saale oder von Lea Lou Kersting und Janina Kraus aus Düsseldorf kommen. Oder von Kappes & Kappes aus Bergen-Enkheim, von ArsGalea aus Burkhardtsdorf oder eben von Comtesse aus Obertshausen. Kennen Sie nicht? Googeln Sie sie mal – und seien Sie nicht zu enttäuscht über teilweise unspektakuläre Internetseiten. Die Taschen wären Ihre Aufmerksamkeit schon wert. Und den Preis sind sie es auch. Denn wo 10 Stunden Arbeit drin stecken, müssen 1000 Euro drauf stehen. Jedenfalls bei einem regulären Handelsartikel.
Wenn bei uns am Messestand über die Preise gemosert wird, dann frage ich gerne: „Wie viele Silberbestecke wollen sie sich denn in ihrem Leben kaufen?“ Oder: „Wie viele Personen leben denn in ihrem Haushalt? Ach, nur sie allein? Dann kaufen Sie sich doch einfach ein Messer, eine Gabel, einen Löffel und einen Kaffeelöffel – da sind sie deutlich unter 800 Euro. Und wenn dann mal Besuch kommt, leisten sie sich einfach einen zweiten Satz, falls sie ihren Besuch überhaupt mit Silber bewirten wollen.“ Mal ehrlich – warum sollen wir für jemanden ein Silberbesteck herstellen, der noch nicht einmal den Silberpreis bezahlen will? Es ist aber auch ein typisches Beispiel für Kunden, die Manufaktur mit Marke verwechseln.
Ganz offensichtlich denken viele Kunden, dass sie von einer Marke beim Preis sowieso hemmungslos über das Ohr gehauen werden. Andreas Mann, Geschäftsführer von Comtesse, hat dazu auf dem 3. Zukunftsforum Deutsche Manufakturen in Solingen die Theorie aufgestellt: Viele Menschen, insbesondere auf dem deutschen Markt, seien heutzutage gar nicht mehr in der Lage, Qualitäten zu unterscheiden. Deshalb klammerten sie sich auch so sehr an Marken und Labels als Orientierungspunkte – obwohl sie sich gerade von diesen beim Preis über den Tisch gezogen fühlen. Daher wahrscheinlich auch der große Spaß am Preis-Schnäppchen. Denn ein anderer oft gehörter Hersteller-Spruch ist: Wir Deutschen seien am Vormittag als Kunden Gutmenschen – und gingen am Nachmittag im Internet auf Schnäppchenjagd.
Es hat etwas von Absurdität, wenn man ein Produkt für den einheimischen Markt aus Kostengründen nur im Ausland produzieren lassen kann. Denn das bedeutet ja nur, dass die Kunden den Preis der Fertigung bei sich zu Hause nicht bezahlen wollten. Und dass das Produkt nur durch eine Art Ausbeutung – das Nutzen der schlechten Entlohnung der Arbeitnehmer in Schwellen- und Entwicklungsländern und das Inkaufnehmen von nach unserem gesellschaftlichen Verständnis unmöglichen Arbeitsbedingungen – zu einem für uns akzeptablen Preis gefertigt werden kann.
Ich proklamiere nicht gleich: „Buy German“. Auch nicht: Kaufen Sie keine Industrieprodukte. Sondern: Wenn Sie es irgendwie können, dann kaufen Sie nachhaltige Produkte. Nachhaltig auch im Sinne der Frage, ob das Produkt wohl wirklich zu diesem niedrigen Preis unter akzeptablen Bedingungen gefertigt werden konnte.
Denn ein ganz anderes Problem lässt sich damit auch erschlagen: das der Konsumunlust. Denn mal ganz ehrlich: Macht der Medion-Lautsprecher, gekauft bei Aldi, tatsächlich satt? Oder sollte man nicht einfach mal über Ceratec aus Bremen nachdenken oder sogar über einen CD-Player von Restek aus dem hessischen Fuldabrück? In dieser Manufaktur gibt es immerhin eine lebenslange Nachrüst-Garantie für später verbesserte Bauteile. Klar kostet die gefräste Edelstahlfront Geld – aber dafür kann man die Leute, die diese Spezialteile ausgetüftelt und oft auch persönlich zusammengeschraubt habe, einmal alles fragen, was man dazu schon immer mal fragen wollte. Manufaktur-Produkte machen eben satt und zufrieden. Nachhaltig.
P. S.: Ach, Sie hören keine Scheiben mehr? Na, dann weiterhin viel Spaß auf dem Weg ins Pay-per-hear bei iTunes & Co. Immerhin kann dann ein anderes Überwachungsprogramm permanent registrieren, was Sie wirklich hören. Und vielleicht gibt es bald ja auch eine kostenpflichtige Schnittstelle für Konsumforscher bei der NSA – dann würden sich ganz neue Wirtschaftskreisläufe schließen.
Fotos: Louis Koch, Wigmar Bressel, privat
Dieses Essay erschien im Jahr 2014 in der Zeitschrift ‚Objects No. 7‘ des Direktorenhaus – Museum für Kunst, Handwerk und Design